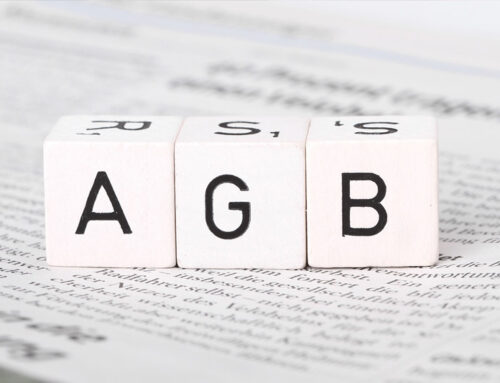Start-ups sind das Herzstück vieler innovativer Märkte und eine treibende Kraft hinter technologischen und gesellschaftlichen Veränderungen.
In Österreich, wie auch weltweit, gibt es eine ständig wachsende Zahl von Unternehmensgründungen, die mit neuen Ideen und kreativen Ansätzen den Markt revolutionieren möchten. Doch trotz der Begeisterung und des Potenzials, das viele Start-ups mitbringen, scheitern leider viele innerhalb der ersten Jahre ihres Bestehens. Laut einer Studie des Instituts für Mittelstandsforschung scheitern etwa 50 % der Start-ups innerhalb der ersten fünf Jahre.
Ein häufig unterschätzter Aspekt des Unternehmensaufbaus ist die rechtliche Begleitung und Absicherung. Der wirtschaftliche Erfolg hängt in vielen Fällen nicht nur von der Geschäftsidee, sondern auch von der richtigen rechtlichen Struktur und den richtigen Entscheidungen ab. Hier kommt das Wirtschaftsrecht ins Spiel, das eine entscheidende Rolle beim Erfolg oder Misserfolg eines Start-ups spielt.
In diesem Artikel möchten wir uns mit den häufigsten Fehlern auseinandersetzen, die Start-ups in Österreich machen, und Ihnen Lösungsansätze aus der Perspektive des Wirtschaftsrechts aufzeigen.
Nachfolgend nun die 6 häufigsten Fehler von Start-ups und unsere Lösungsansätze dazu
1. Fehler bei der Wahl der Unternehmensform
Die Wahl der richtigen Unternehmensform ist eine der ersten und wichtigsten Entscheidungen, die ein Start-up treffen muss. In Österreich gibt es verschiedene Rechtsformen, darunter die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), die Aktiengesellschaft (AG), die Offene Gesellschaft (OG) und die Kommanditgesellschaft (KG). Jede dieser Rechtsformen hat unterschiedliche rechtliche, steuerliche und finanzielle Implikationen.
Fehler
Ein häufiger Fehler bei der Wahl der Unternehmensform ist, dass Gründer sich nicht ausreichend mit den Vor- und Nachteilen der jeweiligen Rechtsform auseinandersetzen.
Insbesondere junge Gründer neigen oft dazu, aus Unwissenheit oder aufgrund eines geringen Anfangskapitals eine Personengesellschaft (wie etwa eine OG oder KG) zu gründen, obwohl eine GmbH – trotz des höheren Stammkapitals – langfristig eine sicherere Wahl darstellt, um das Haftungsrisiko zu minimieren.
Lösungsansatz
Start-ups sollten sich frühzeitig mit einem Anwalt und einem Steuerberater beraten, um die für sie passende Unternehmensform zu wählen. Besonders zu beachten sind dabei Haftungsfragen, die steuerliche Belastung und die Flexibilität in der Unternehmensführung.
Eine GmbH ist oft eine sehr gute Wahl, da sie den Vorteil der Haftungsbeschränkung bietet, was insbesondere für Gründer wichtig ist, die nicht mit ihrem Privatvermögen haften möchten.
2. Mangelhafte Vertragsgestaltung bei Gesellschaftsverträgen (Gründervereinbarungen) und Investorenverträgen
Ein weiterer häufiger Fehler von Start-ups ist die unzureichende oder mangelhafte Vertragsgestaltung bei wichtigen Vereinbarungen, insbesondere bei Gesellschaftsverträgen und Investorenverträgen. Diese Dokumente sind nicht nur wichtig für die Unternehmensführung, sondern auch für die rechtliche Absicherung der Beteiligten.
Fehler
Oftmals wird der Gründervertrag ohne juristische Unterstützung erstellt oder es wird auf Musterverträge aus dem Internet zurückgegriffen, ohne dass die spezifischen Bedürfnisse und Strukturen des Unternehmens berücksichtigt werden. Dies kann später zu Problemen führen, etwa bei der Aufteilung von Unternehmensanteilen, der Regelung von Entscheidungsbefugnissen oder der Einigung über den Exit-Plan.
Bei Investorenverträgen gibt es ebenfalls häufige Fehler, wie z.B. unklare Regelungen zu den Rechten und Pflichten der Investoren, den Eigenkapitalanteilen oder den Exit-Strategien. Dies führt oft zu Konflikten, die die langfristige Stabilität des Unternehmens gefährden können.
Lösungsansatz
Es ist entscheidend, von Beginn an einen klaren und rechtlich wasserdichten Gründervertrag zu erstellen. Dieser sollte nicht nur die vertraglichen Grundlagen für die Zusammenarbeit regeln, sondern auch mögliche Szenarien wie den Fall des Ausscheidens eines Gründers oder die Aufteilung von Unternehmensgewinnen und Anteilen behandeln. Ebenso sollten Investorenverträge klar und transparent formuliert werden, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
Juristische Unterstützung ist hierbei unerlässlich, da diese Verträge langfristige Auswirkungen auf das Unternehmen und seine Struktur haben. Eine frühzeitige rechtliche Beratung kann helfen, viele spätere Probleme zu vermeiden.
3. Unzureichende Finanzierung und Kapitalstruktur
Einer der größten Gründe, warum Start-ups scheitern, ist unzureichende Finanzierung. Selbst die besten Ideen benötigen Kapital, um zu wachsen. Ein häufiger Fehler in dieser Hinsicht ist eine unzureichende Planung der Kapitalstruktur und der Finanzierungsmöglichkeiten (oft kein Businessplan vorhanden).
Fehler
Viele Gründer verlassen sich zunächst auf Eigenkapital oder kleine Kredite, um das Unternehmen zu finanzieren, ohne die langfristigen finanziellen Bedürfnisse ihres Unternehmens realistisch einzuschätzen. Dies führt häufig dazu, dass das Unternehmen schnell mit Liquiditätsproblemen konfrontiert wird, insbesondere wenn es nicht gelingt, in einer frühen Phase ausreichend Investoren oder weitere Finanzierungsmöglichkeiten zu gewinnen.
Ein weiterer Fehler ist das falsche Management von Eigenkapital und Fremdkapital. Zu viele Anteile des Unternehmens an Investoren abzugeben oder zu hohe Schulden aufzunehmen, kann die Zukunft des Unternehmens gefährden.
Lösungsansatz
Eine frühzeitige und realistische Finanzplanung ist entscheidend. Gründer sollten sich nicht nur auf Bankkredite verlassen, sondern auch alternative Finanzierungsquellen wie Business Angels, Risikokapital oder Crowdfunding in Betracht ziehen. Eine ausgewogene Kapitalstruktur, bei der das Verhältnis von Eigenkapital und Fremdkapital sinnvoll gewählt wird, ist ein wichtiger Schritt, um das Unternehmen langfristig auf ein solides Fundament zu stellen.
Gründer sollten außerdem regelmäßig ihre Liquidität überwachen und entsprechende Finanzpläne erstellen, die nicht nur das Wachstum des Unternehmens, sondern auch unvorhergesehene Risiken berücksichtigen.
4. Fehlende oder unzureichende Schutzrechte für geistiges Eigentum
Gerade in technologieorientierten Start-ups, die oft auf neuen Ideen, Produkten oder Software basieren, ist der Schutz geistigen Eigentums von entscheidender Bedeutung. Ein häufiger Fehler ist, dass Gründer ihre Erfindungen oder Ideen nicht ausreichend schützen, was zu erheblichen Verlusten führen kann, wenn Wettbewerber ähnliche Produkte oder Technologien entwickeln.
Fehler
Viele Start-ups vernachlässigen es, Patente, Markenrechte oder Urheberrechte anzumelden, bevor sie ihre Produkte auf den Markt bringen. In anderen Fällen wird geistiges Eigentum nicht klar auf das Unternehmen übertragen, wenn mehrere Gründer an der Entwicklung beteiligt sind. Dies kann später zu Streitigkeiten über die Rechte an einer Technologie oder einem Produkt führen.
Lösungsansatz
Start-ups sollten so früh wie möglich eine umfassende Strategie für den Schutz ihres geistigen Eigentums entwickeln. Dies kann die Anmeldung von Patenten, Marken oder Designs umfassen, aber auch die Sicherstellung der Rechte an Software und anderen innovativen Produkten.
Ein erfahrener Anwalt für gewerblichen Rechtsschutz kann helfen, die richtigen Schritte zu unternehmen und sicherzustellen, dass das Unternehmen seine Innovationskraft vor möglichen Nachahmern schützt.
5. Vernachlässigung der rechtlichen Compliance und der regulatorischen Anforderungen
Start-ups haben oft die Herausforderung, in einem dynamischen Marktumfeld zu agieren. Dabei werden rechtliche Compliance-Vorgaben und regulatorische Anforderungen nicht selten als bürokratische Hürde wahrgenommen und vernachlässigt.
Fehler
Ein häufiger Fehler ist, dass Start-ups die erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen oder Marktanalysen nicht einholen, die für den Betrieb ihrer Produkte oder Dienstleistungen notwendig sind. Insbesondere in regulierten Branchen wie der Finanz-, Gesundheits- oder Lebensmittelindustrie kann dies zu rechtlichen Problemen und teuren Sanktionen führen.
Lösungsansatz
Es ist wichtig, dass Start-ups sich von Anfang an mit den relevanten gesetzlichen Anforderungen und regulatorischen Vorgaben auseinandersetzen. Eine frühzeitige Beratung durch einen Rechtsanwalt, der auf Wirtschaftsrecht oder das jeweilige Spezialgebiet des Start-ups spezialisiert ist, kann helfen, rechtliche Stolpersteine zu vermeiden.
6. Mangelnde Skalierbarkeit und fehlende Anpassung an Marktveränderungen
Ein weiteres häufiges Problem von Start-ups ist die fehlende Skalierbarkeit und die mangelnde Anpassungsfähigkeit an Marktveränderungen. Dies betrifft nicht nur die Geschäftsstrategie, sondern auch die rechtlichen Strukturen.
Fehler
Viele Start-ups konzentrieren sich zunächst nur auf ein kleines Marktsegment und vernachlässigen es, ihre Geschäftsmodelle und rechtlichen Strukturen so anzupassen, dass sie auch auf größere Märkte oder internationale Märkte skalierbar sind. Dies betrifft sowohl die Unternehmensorganisation als auch die rechtlichen Vereinbarungen mit Partnern oder Kunden.
Lösungsansatz
Start-ups sollten ihre Geschäftsmodelle und rechtlichen Strukturen von Anfang an so gestalten, dass eine Skalierung möglich ist. Dies betrifft nicht nur die Finanzstruktur, sondern auch die Verträge und die rechtlichen Vereinbarungen mit Partnern und Kunden. Flexibilität und die Bereitschaft zur Anpassung an neue Marktbedingungen sind für den langfristigen Erfolg von entscheidender Bedeutung.
Unser Fazit
Die Gründung eines Start-ups ist eine aufregende und herausfordernde Reise. Viele der häufigen Fehler, die Start-ups in Österreich machen, sind auf mangelnde rechtliche Planung und fehlende rechtliche Beratung zurückzuführen. Eine fundierte rechtliche Begleitung von Beginn an kann dazu beitragen, diese Fehler zu vermeiden und das Unternehmen langfristig auf Erfolgskurs zu bringen.
Ein erfahrener Anwalt für Wirtschaftsrecht kann Start-ups nicht nur bei der Wahl der richtigen Unternehmensform und der Gestaltung von Verträgen unterstützen, sondern auch bei der Finanzierung, dem Schutz geistigen Eigentums und der Sicherstellung der rechtlichen Compliance. Wer diese Aspekte von Anfang an berücksichtigt, erhöht seine Chancen auf langfristigen Erfolg und vermeidet teure und risikobehaftete Fehler.
Die Entscheidung, sich selbständig zu machen, ist ein großer Schritt und kann sowohl herausfordernd als auch äußerst bereichernd sein. In Österreich gibt es zahlreiche Aspekte, die beachtet werden sollten, um den Start in die Selbständigkeit erfolgreich zu gestalten. In diesem Artikel möchten wir Ihnen einige nützliche Tipps geben, die Ihnen bei der Gründung Ihres Unternehmens helfen können.